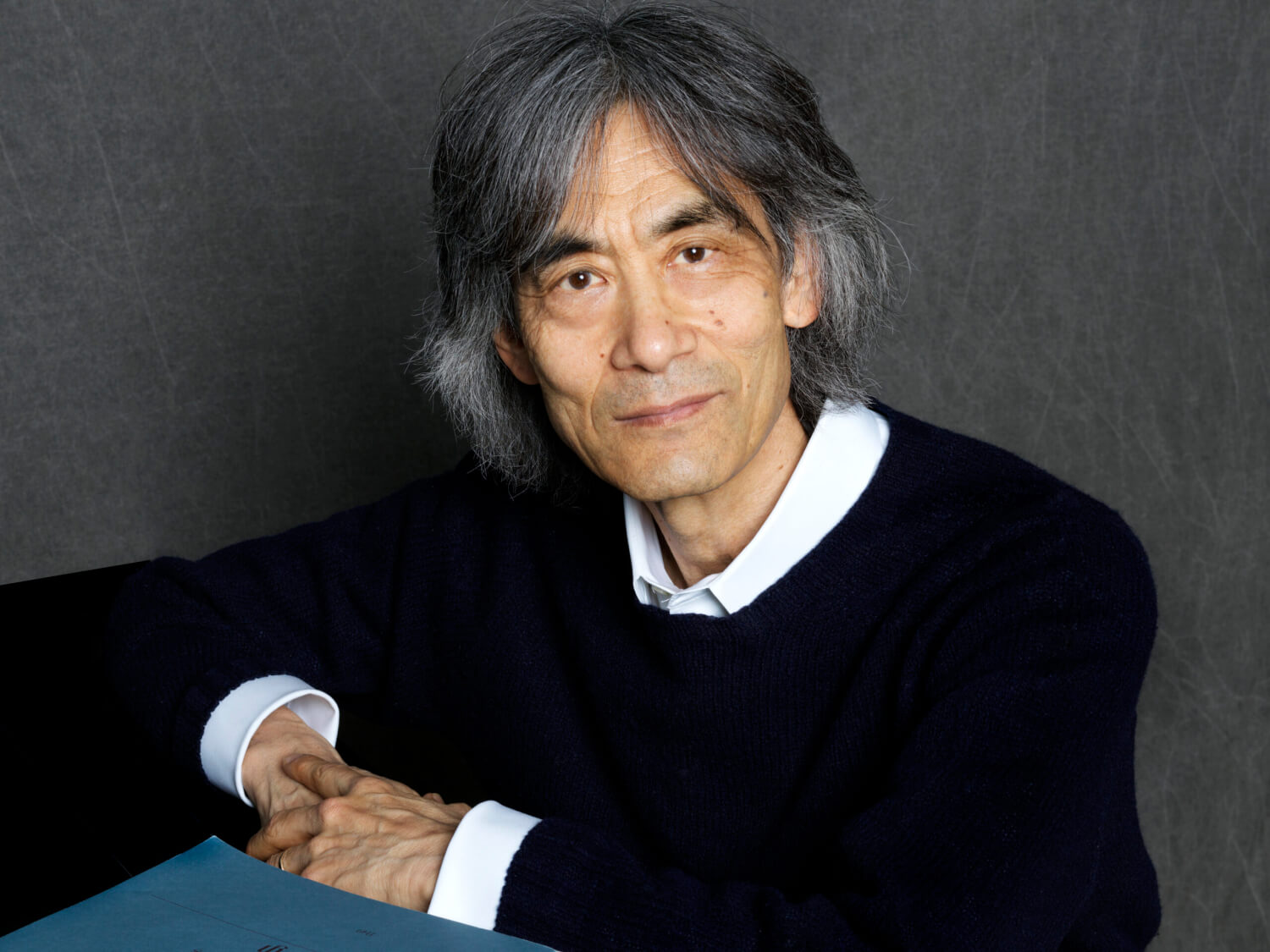
Historisch informierter Wagner?
Foto: Kent Nagano © Sergio Veranes Text:Andreas Falentin, am 21. Oktober 2019
Seit 20 Jahren gewinnt die sogenannte Originalklang-Bewegung immer größeren Raum im Konzert-, Opern- und Tonträgerbetrieb. In der alten Musik ist sie bereits führend, in der Wiener Klassik zumindest konkurrenzfähig. In die romantische und impressionistische Musik gab es aber bislang nur vereinzelte Ausritte, etwa Thomas Hengelbrocks bemerkenswerter „Rigoletto“ 2004 in Baden-Baden oder Francois-Xavier Roths Einspielung von Ravels „Daphnis et Chloe“ von 2017. Im Großen und Ganzen aber scheint sich besonders die hoch- und spätromantische Musik als Refugium der großen, lauten, auf traditionellen Klang- und Wirkungsvorstellungen aufsetzenden Sinfonieorchester zu erhalten.
Vor drei Jahren haben sich nun das eigentlich musikalisch im 18. Jahrhundert beheimatete Orchester Concerto Köln, der Dirigent Kent Nagano und ein Team von Musikwissenschaftlern zum Projekt Wagner-Lesarten zusammengefunden. Ziel der im letzten Jahr aufgenommenen, gemeinsamen Arbeit ist eine historisch informierte Aufführung des „Ring des Nibelungen“, vor allem aber die „Rekonstruktion der Instrumental-, Gesangs-, Sprach- und Bühnenpraxis der Wagner-Zeit“. Gestern Abend gab es zum zweiten Mal die Möglichkeit, erste Forschungsergebnisse in der Praxis, im Konzert zu hören.
Gab es im Frühjahr am selben Ort die von Felix Mottl orchestrierten Wesendonck-Lieder in Kombination mit Bruckners dritter Sinfonie zu hören, stand jetzt erstmals Original-Wagner auf dem Programm. Die „Tannhäuser“-Ouvertüre in der französischen Fassung, also um das Bacchanal erweitert, wurde mit Debussys „Nocturnes“ und dem Antonia-Akt aus „Hoffmanns Erzählungen“ kombiniert.
Das Konzert verblüffte und faszinierte, allerdings nicht, weil alles „neu“ oder „historisch“ klang. Sondern weil hier schlicht lustvoll musiziert wurde. Hier geht es nicht um wirkungsorientierte Oberflächenpolitur, um altmeisterliche oder sonstige Traditionen und Klischees („Deutscher Klang“, „samtig dunkle Streicher“). Nagano und Concerto Köln machen Musik und haben hörbar großen Spaß dabei. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem in der Partitur und in Schriftzeugnissen niedergelegten Komponistenwillen, gehen aber nicht intellektuell überformend und interpretierend, sondern eben musikantisch damit um. Und haben dabei, fern von beispielsweise dem Originalitätsbedürfnis eines Teodor Currentzis, immer Charakter und Dramaturgie des ganzen Werks in Ohr und Blick.
Und Wagners Ouvertüre swingt wie selten. Die Unterschiede machen es. Und vor allem die Transparenz. Man hört etwa, wie sonst nie, wie viel Impulse von den Fagotten ausgehen, wie sie ein Zentrum dieses komplexen musikalischen Gebildes sind. Und dass die Streicher nicht von den Bläsern zugedeckt gehören, sondern das wesentliche Gegengewicht zu ihnen bilden. Kein „Schrumm-Schrumm“ unter Bläserwonne ist hier zu hören, sondern diese konterkarierende sichelnde kurze, elastisch federnd gespielte Streicherlinien, die fast Richtung Minimal Music schauen. Auch wenn die Tempi momentweise vor Langsamkeit etwas über den Boden zu schleifen scheinen: eine aufregende Lesart. Und das Bacchanal setzt noch eins drauf: Wild, sinnlich, unbeherrschbar klingt das, fast wie gesteigerter „Tristan“ mit unerträglichem Morgen danach, der dann seine fast folgerichtig wirkende Fortsetzung findet in Debussys drei kurzen Nocturnes, die er selber als „Studien in Grau“ sah. Das Sich Abarbeiten an der Idee der Romantik verbindet beide Komponisten überraschend eng. Dirigent und Orchester arbeiten das symbiotisch heraus, ihre Vertrautheit miteinander ist fast mit Händen zu greifen. Die Musiker musizieren lustvoll und Nagano weiß genau, wo er sie loslassen und Klangfarben entbinden und strukturieren kann und wo er schlicht für die musikalische Stabilität gebraucht wird. Dass nach dieser Konzerthälfte bekannt gegeben wird, dass Concerto Köln Nagano zum Ehrendirigenten ernannt hat, verwundert nicht.
Nach der Pause Gesang. Also Butter bei die Fische. Wird das Projekt Wagner-Lesarten einen neuen Weg weisen zu zeitgemäßem romantischem Singen? Die musikalische Dramaturgie des Aktes gelingt grandios. Vor allem zum Ende hin, wo Nagano keinen romantischen Überschwang zulässt, sondern in der Spur des Stückes bleibt. Er modelliert ein übergroßes, in der Größe ironisiertes Konversationsstück mit großer Melodienvielfalt, eben ein mit Offenbach-Fleisch gefülltes romantisches Skelett.
Und der Gesang? Da trifft mitreißende jugendliche Stimmschönheit und -kraft (Sébastien Guèze als Hoffmann, Ida Ränzlöv als Nicklausse) auf Originalklang-Expertise und -Eleganz (Andrew Foster-Williams als Docteur Miracle, Stefanie Iranyi als Stimme der Mutter). Kleinster gemeinsamer Nenner scheint ein schlanker Tonansatz zu sein, ein möglichst unaffektiertes, vom Wort herkommendes Singen und der Verzicht auf Vibrato, wo immer es möglich ist. Dazwischen singt aber mit Jessica Nuccio eine Antonia, die mit viel Vibrato anfängt, dieses dann zurücknimmt und doch seltsam defensiv und ausdrucksarm bleibt – und wenig textverständlich. Da scheint der Weg noch weit zur Reformation und Vereinheitlichung des romantischen Operngesangs.
Der Instrumentalzugriff hingegen hat jetzt schon etwas Befreiendes, bricht Verkrustungen auf, will neue Hörwege ins Altbekannte öffnen und wird das auch schaffen. Aber wie wird das Theater mit dieser neuen Freiheit umgehen? Minimalistisch? Tänzerisch? Immer noch narrativ? Da wird’s dann wirklich spannend, vielleicht, irgendwann nach 2021…


