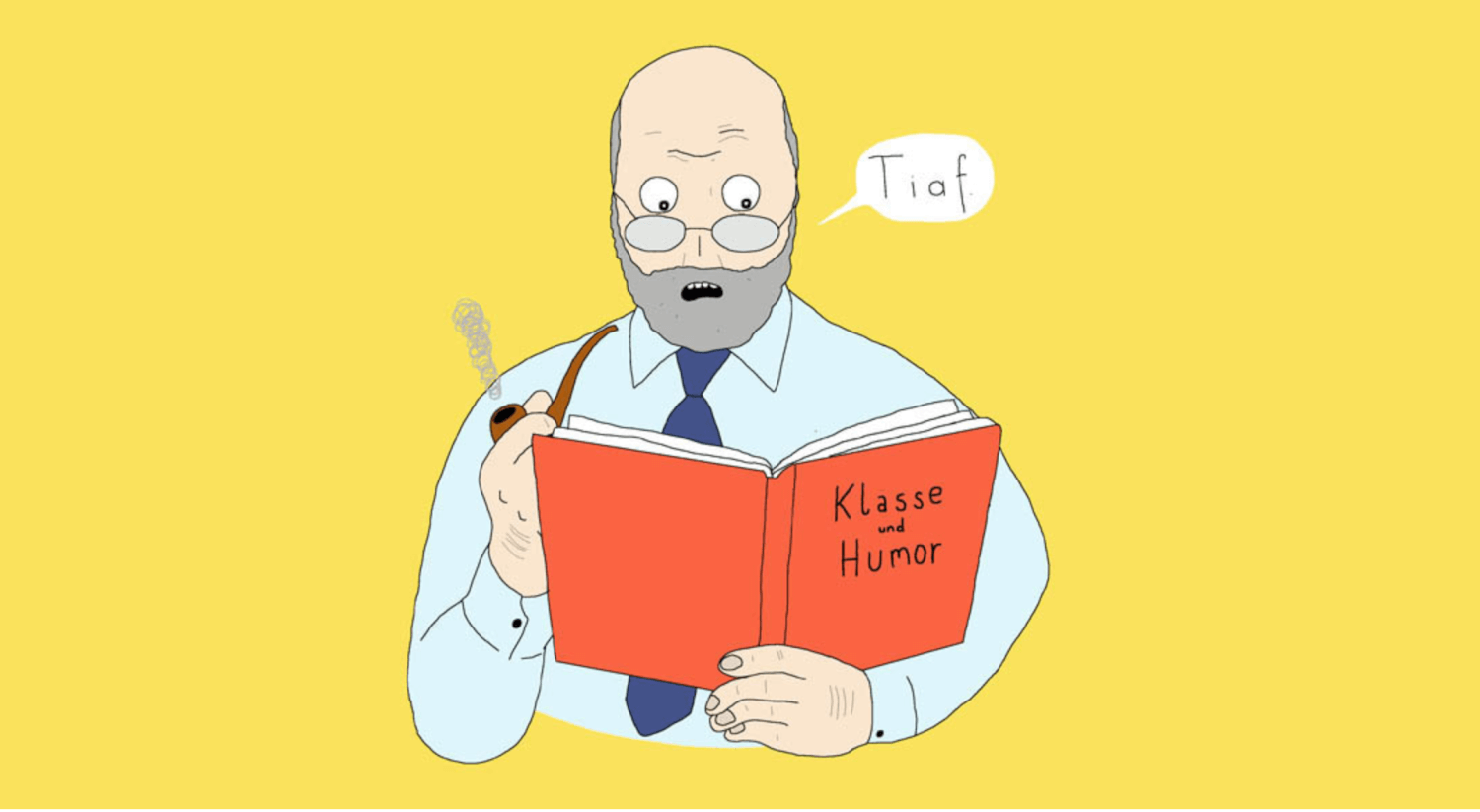Eine neue Post-Dramatik? – Blog in vier Teilen
Foto: Die Kleist-Briefmarke des Nationaltheaters Mannheim © Nationaltheater Mannheim Text:Andreas Falentin, am 6. April 2021
Obwohl sie geschlossen sind, versuchen die Theater, ihre Inhalte weiter ans Publikum zu bringen und haben dabei eine ungewöhnliche Formenvielfalt kreiert, von der „normal“ abgefilmten Vorstellung bis hin zu Filmen, Webserien, Online-Games und Teleshopping- und Showformaten. Das Nationaltheater Mannheim macht jetzt einen Schritt zurück ins Analoge. Aus der geplanten Uraufführung „Gott Vater Einzeltäter – Operation Kleist“ von Necati Öziri ist vorläufig „Cecils Briefwechsel“ geworden, als „Post-Drama“. Jede Zuschauerin bekommt und schreibt tatsächlich – Briefe. Viermal. Ich mache mit.
Dienstag, 6. April
Vorbei. Das letzte Teelicht verglimmt. Das letzte Salbeiblatt verräuchert. Obwohl man mir einen unadressierten, frankierten Umschlag mitgeschickt hat, um mit einem Menschen meiner Wahl eine Diskussion über die in unseren Briefen angerissenenen Themen eine Aufbaudiskussion zu beginnen: „Cecils Briefwechsel“ ist für mich vorbei.
Der letzte Brief zeigt noch einmal eine ganz andere Facette, nicht nur, weil die Post über Ostern einmal ihr Normaltempo erreicht hat. Auch gibt es keine neue Erzählung mehr, keine neue, Aktualität intensiv und geschmackvoll spiegelnde Metamorphose eines Kleist-Stoffes mehr. Sondern die Rahmenerzählung aus dem ersten Teil – empathische, ein Leben ohne Herabsetzungen anderer propagierende Menschen versammeln sich friedlich in einer Kirche, eine Gruppe Männer will ihr Treffen gewaltsam unterbinden – wird zu einem utopischen Ende geführt: Die Terror-Kerle haben eine Art spirituelles Erweckungserlebnis, das sie enthemmt und von ihrer gesellschaftlichen Rolle und damit von ihren Aggressionen befreit. Schon die heutige Versuchsanordnung wirkt überraschend fröhlich:
Eine Wunderkerze? Gar Luftschlangen?? Der Text, begonnen wieder mit einem individuellen, mein letzten Brief berührend freundlich reflektierendem Anschreiben ist leichter im Ton, wechselt ansatzlos von Poesie zu Umgangssprache („dieses Minderwertigkeits-dings-bums“), verblendet dann wieder hoch originell beide Sprachebenen („Große, dicke, kleine, schrumpelige Männer / mit und ohne Brille / mit und ohne Hühnerbrüste (…)“), zitiert Prince, spielt auf Simone de Beauvoir an, frönt also auf mehreren Ebenen dem Eklektizismus. Selbstgewisses Mäandern tritt an die Stelle poetischer Stringenz. Nach wie vor habe ich Probleme mit der Prämisse. Die sagt, die Gesellschaft dränge die, sozusagen, alten weißen männlichen Kinder in eine bestimmte Rolle, die es fast sicher mit toxischer Männlichkeit infiziert. Das mag zu Kleists Zeiten so gewesen sein. Heute dürfen wir uns Kerle aber eigentlich nicht mehr auf so etwas raus reden. Wir sind – erwachsen – für unser Gift selbst verantwortlich.
Aber der Rest ist, auch in diesem Schlussteil, klug und haltungsstark. Und das Frauenbild, das mit sanfter Ironie bloßgelegt wird (leidensfähiger, leichter beeinflussbar, leichter therapierbar…) ist möglicherweise in unserer Männerwelt immer noch mehrheitsfähig.
Ich bin dankbar, dabei gewesen zu sein. Ich hatte Spaß, ich bin berührt worden, ich denke anders über Dinge nach, vielleicht denke ich auch über andere Dinge nach. So habe ich erst auf der letzten Rille bewusst wahrgenommen, dass „Cecil“ gar kein Mann ist. Sie unterschreibt mit „Deine Cecil“. Auf solche Dinge sollen wir achten, ohne uns mit pauschaler Achtsamkeit abzustumpfen. Und mal nach Mannheim fahren, zumindest ich, wenn die Theater endlich wieder aufmachen. Die sind freundlich bis hin zur letzten Briefmarke!
Dienstag, 30. März
Dieses Mal war nicht die Post schuld. Jedenfalls nicht allein. 15 Tage hin und zurück ist immer noch eine Menge. Dazu: Krankheit, Urlaub, Arbeit. Irgendwann mittendrin kam der Brief, löste Freude aus – und musste warten. Er sollte keine Lücke füllen. Heute war die nötige Stunde Ruhe. Ich habe den Umschlag geöffnet und die neue Versuchsanordnung vor mir ausgebreitet:
Dieses Mal „Michael Kohlhaas“. Die Geschichte ist bekannt, mir seit Schulzeiten. Der Vorzeige-Händler, das Muster an Gewissenhaftigkeit und Sozialkompetenz wird Opfer der Willkür der Mächtigen. Sein Handelsgut kommt zu Schaden, seine Frau, die vermitteln will, stirbt. Kohlhaas wird zum radikalen Gewalttäter. Wieder fasziniert die Fähigkeit des Autors Necati Öziri, Heinrich von Kleists Sprache zu entzerren, ohne dass das dramatische Geschehen – auch im Erzählen bleibt Kleist immer Dramatiker – an Poesie und Dynamik verliert. Und der Kern wird herausgeschält, die Machtlosigkeit den Mächtigen gegenüber, die Hilflosigkeit und Selbstbezogenheit, die zur Radikalisierung führt und hier zu einer Art Vereinigung von Radikalen aus vielen Ländern führt. Hier wird meine Vorstellungskraft gesprengt. Ich will mir Gewalt-Radikale in Gedanken und Taten nicht als soziale Wesen vorstellen. Für mich verlässt ein radikaler Gewalttäter geistig nie seine eigene Türschwelle und ist unfähig zu einer von Empathie geprägten Gemeinschaft.
Aber darum geht es hier nicht. Was mir gefällt: Immer wieder dringt Humanität durch die Ritzen, geadezu Zärtlichkeit, etwa im Umgang des Ehepaars Kohlhaas miteinander. Der Titelheld ist Pferdehändler. Und weil auf seine Pferde, die er zum Pfand zurücklassen musste, nicht achtgegeben wird, wird er doppelt wütend – seine Handelsware wird beschädigt, Leben wird gequält. Was ist wichtiger? Ich habe ein paar Strohhalme auf meinem Schreibtisch zu arrangieren, Streu und Fürsorge für die Pferde, und eine Kerze daraufzustellen. Fast ein Altärchen:
Mich persönlich ergreift an der ganzen Angelegenheit heute etwas anderes: Diese Hilflosigkeit, der Necati Öziri auf Basis von Kleists Text, zugespitzt von Regisseurin Sapir Heller und Dramaturgin Lena Wontorra, so beredt Ausdruck verleiht, mit genau dieser Hilflosigkeit stehe ich gleich doppelt vor der aktuellen Pandemie. Da ist das Virus, dem man anscheinend nicht Herr werden kann, und da ist das Krisenmanagement der Spitzenpolitik, das nicht nur plan- und systemlos wirkt, sondern bei dem vor allem – selbstverständlich ein subjektiver Eindruck – ich, wir, die Menschen nicht mitgedacht und -gefühlt werden. Etwas stimmt nicht, ist aus den Fugen, in mir und außer mir. Und damit mir das ganz klar wird, findet „Cecils Briefwechsel“ sogar hierfür einen Sinneseindruck: Brausepulver aus der Zunge. Das marodiert dann über die Lippen und durch Mund und Rachen. Störend. Unbeherrschbar. Nicht zu ignorieren. Und viel zu süß.
Auch hier sind wir wieder direkt bei Kleist, bei seinen Gedankenstrichen, die Unmögliches voneinander trennen und die Unmöglichkeit harmonischen Lebens behaupten. „Das Gefühl des vollkommenen Widerspruchs in allen Dingen“ hat der Dramatiker Christian Friedrich Hebbel das später genannt. Das ist extrem deprimierend, aber „Cecils Briefwechsel“ verlebendigt, versinnlicht diesen Ansatz, analytisch mit fatalistischer Hoffnungslosigkeit umzugehen. Besonders mit der eigenen. Das macht lächeln. Zumindest mich. Ich freue mich sehr auf den vierten Brief und bedaure, dass es der letzte ist.
Mittwoch, 3. März
Endlich ist der zweite Brief da. Ich hatte schon Sorge, vor allem, weil ich so neugierig bin. Zu Kleists Zeiten bewegte sich eine Postkutsche mit ungefähr 8 Kilometern pro Stunde vorwärts. Mannheim – Köln und zurück wäre also in sechs Tagen machbar gewesen. Im Moment schafft die Post das offensichtlich nicht. Die Gefahr des Analogen, sozusagen.
Egal. Ich mache den Brief auf und erwarte Antworten auf meine Fragen. Werde ich mich wieder pauschal, also qua Geschlecht, toxischer Männlichkeit angeklagt fühlen müssen? Wird mich die Faszination wieder einfangen wie beim ersten Mal, über die Sprache und die phantasievolle Vielfalt der Mittel. Wie geht die Beschäftigung mit Kleist weiter, bleiben wir bei derselben Vorlage? Was kommt Neues dazu? Vor allem aber: Bekomme ich tatsächlich, wie annonciert, eine persönliche, auf meinen Brief reagierende Antwort? Wie sollte das denn gehen, bei 8 Durchgängen á 100 Teilnehmer? Da müsste ja jemand, ein Team, eine vierstellige Anzahl Briefe lesen und schreiben…
Tatsächlich! Es ist nicht nur die Anrede. Mein Brief ist gelesen worden und auf der ersten Seite wird auf ihn eingegangen. „Cecil“ schreibt mir begütigend aber insistierend und es geht los. Einiges ist gleich oder ähnlich wie beim ersten Mal. Ich soll wieder die Pappkirche aufstellen und mit Teelichtern illuminieren wie vor zwei Wochen (siehe unten), die Musik kommt diesmal nicht aus dem Telefon, sondern aus meinem Handy und Salbei wird auch wieder verbrannt. Und die Setzung der Exposition bleibt eine Krücke: Ein Kreis von Menschen versammelt sich in einer Kirche mit dem Ziel, die friedliche Koexistenz als wesentliche gesellschaftliche Maxime durchzusetzen oder, wie sie es ausdrücken, „eine pluralistische Gesellschaft der Akzeptanz zu feiern.“ Drei Männer, drei Brüder bekämpfen diesen Bund. Warum? Das soll erzählt werden, im ersten Teil, höchst unerfreulich, mit Material aus „Die Verlobung in Santo Domingo“.
Trotz aller Ähnlichkeiten, und obwohl er sogar mit denselben Worten beginnt, ist der zweite Teil ganz anders. Dennoch entsteht auf meinem unaufgeräumten Schreibtisch umgehend wieder eine Theaterbühne, ich bin mein Hauptdarsteller, muss Mann sein, zu „Fickt euch alle“ dreimal auf den Tisch hauen, dafür „Ich liebe dich“ flüstern.
Mein Name sei Achilles:
Das Tattoo weist mir die Rolle des (nicht ansteckenden) Liebenden zu, und das Ziel all meiner Wünsche und Begierden ist die schönste aller Blumen:
Wie platt! Wie witzig!! „Antworte mir, Penthesilea“. Naturgemäß schweigt die Blume. Nichts von Küssen und Bissen. Aus dem immer noch kraftvollen, immer noch poetischen Text von Necati Öziri schälen sich die Figuren. Achilles ist ein Mann, dem es wichtiger ist, geliebt zu werden als zu lieben. Aber so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Egal, wie oft man auf den Tisch haut. Das weiß der Autor auch. Öziri – und die Regisseurin Sapir Heller, die mit der Dramaturgin Lena Wontorra die analoge Umsetzung entwickelt hat – arbeiten sich bewusst und erstaunlich differenziert an jenem preussischen Männerbild ab, an dessen Nicht-Überwindung Heinrich von Kleist vermutlich zugrunde gegangen ist. Natürlich benutzen sie ihre Vorlagen als Material, beschränken sich aber nicht darauf, wie es auf Bühnen und, besonders aktuell, im Netz immer wieder geschieht, die Oberfläche der Texte zu filetieren. Öziri und, auf seiner Spur, Heller und Wontorra sind tief eingedrungen in diese Dichtungen, setzen sie in Beziehung und schälen mit erstaunlicher Stringenz nach und nach ein Bild heraus. Und erreichen damit, was gutes Theater auszeichnet: Die Zuschauerin, der Zuschauer muss sich nicht nur unausweichlich mit Text, Aufführung, Aussage auseinandersetzen, sondern auch und vor allem mit sich selbst. Wie ist denn das bei mir und der Liebe? Wie egoistisch, wie selbstlos bin ich? Sag ich nicht. Weiß ich nicht.
Aber das Spiel, ihr Spiel, mein Spiel, es hat mich vollkommen eingefangen. Weil es ernst ist. Und weil es wirklich Spiel ist – und mein Büro wieder stundenlang nach Salbei stinkt. Ich gehe noch weiter: Für mich als Kritiker, vor allem aber, unbedingt, als Zuschauer ist „Cecils Briedfwechsel“ das intensivste Theatererlebnis, seit die Theater geschlossen sind.
Und ich möchte wirklich sehr gern wissen, wie es weitergeht! Oh Post, mach‘ einmal voran!
Dienstag, 16. Februar
Endlich. Der erste Brief war für den 8.2. avisiert, für letzten Montag. Gestern ist er dann gekommen, eine Woche zu spät, gestempelt am 5. Februar. Wir sind also fast schon in der Post-Post-Dramatik gelandet. Ich werde auf jeden Fall heute noch antworten. Damit ich noch eine Antwort bekomme. Das ist ein Gefühl, das ich fast schon vergessen hatte: der analoge Termindruck.
Ich bin neugierig. Wie kann ein Briefwechsel, der, nach der ersten Antwort, für jede und jeden Mitwirkende(n) individuell gestaltet werden soll, über das Private, die sozusagen offiziell persönliche Begegnung hinausweisen? Ich öffne den Briefumschlag, finde ein Typoskript und ein paar Kleinigkeiten, befolge erste Anweisungen und habe eine Art Versuchsanordnung auf meinem Schreibtisch:
Ich beginne zu lesen. Erste Überraschung: Der Text packt unmittelbar. Ich lese ihn schon laut, bevor ich die Anweisung entdecke, genau das zu tun. Es ist harter Text. Gewalt, Gerechtigkeit, Rache sind die Themen. Necati Öziri gebietet über eine genuin dramatische Sprache von großer poetischer Kraft. Und er schließt tatsächlich an Kleist an, nutzt seine Weltsicht, seine Weltbeschreibung als Fundament und die Erzählung „Die Verlobung in Santo Domingo” offensichtlich als Material. Dazu konstruiert er einen Antagonismus aus zwei Gruppen. Die eine lebt aggressiv toxische Männlichkeit aus, die andere sucht Wege dagegen an. Ob das zu Kleists Zeit spielt oder heute, weiß ich nicht genau, spielt aber vielleicht auch keine Rolle. Die „Guten“ versammeln sich in einer Kirche. Zwecks Atmosphäre konnte ich nicht nur eine Telefonnummer anrufen und Musik hören, sondern auch auf meinem Schreibtisch eine Kirche aufstellen und sie beleuchten:
Als sich der Schauplatz dann in die Karibik verlagert, schafft das Verbrennen getrockneten Salbeis Atmosphäre (siehe unten). Auf Anhieb begeistert mich das Vorhaben, die Sprachkraft, mit der hier erzählt und agitiert wird wie die phantasievolle, gar nicht bedeutungsschwanger daherkommende Ausgestaltung. Aber worauf will es hinaus? Werde ich in all meinen Briefen eine Gerechtigkeitsdiskussion führen müssen, mich dafür verteidigen, dass ich ein Mann bin, dem jene vieldiskutierte toxische Männlichkeit nun mal in die DNA geschrieben ist? Oder wird am Ende ein humanistischer Gesellschaftsentwurf stehen, etwas, wovon Kleist ja nur Fetzen aufgefunden hat, worunter er bekanntlich furchtbar litt?
Ich bin gespannt…