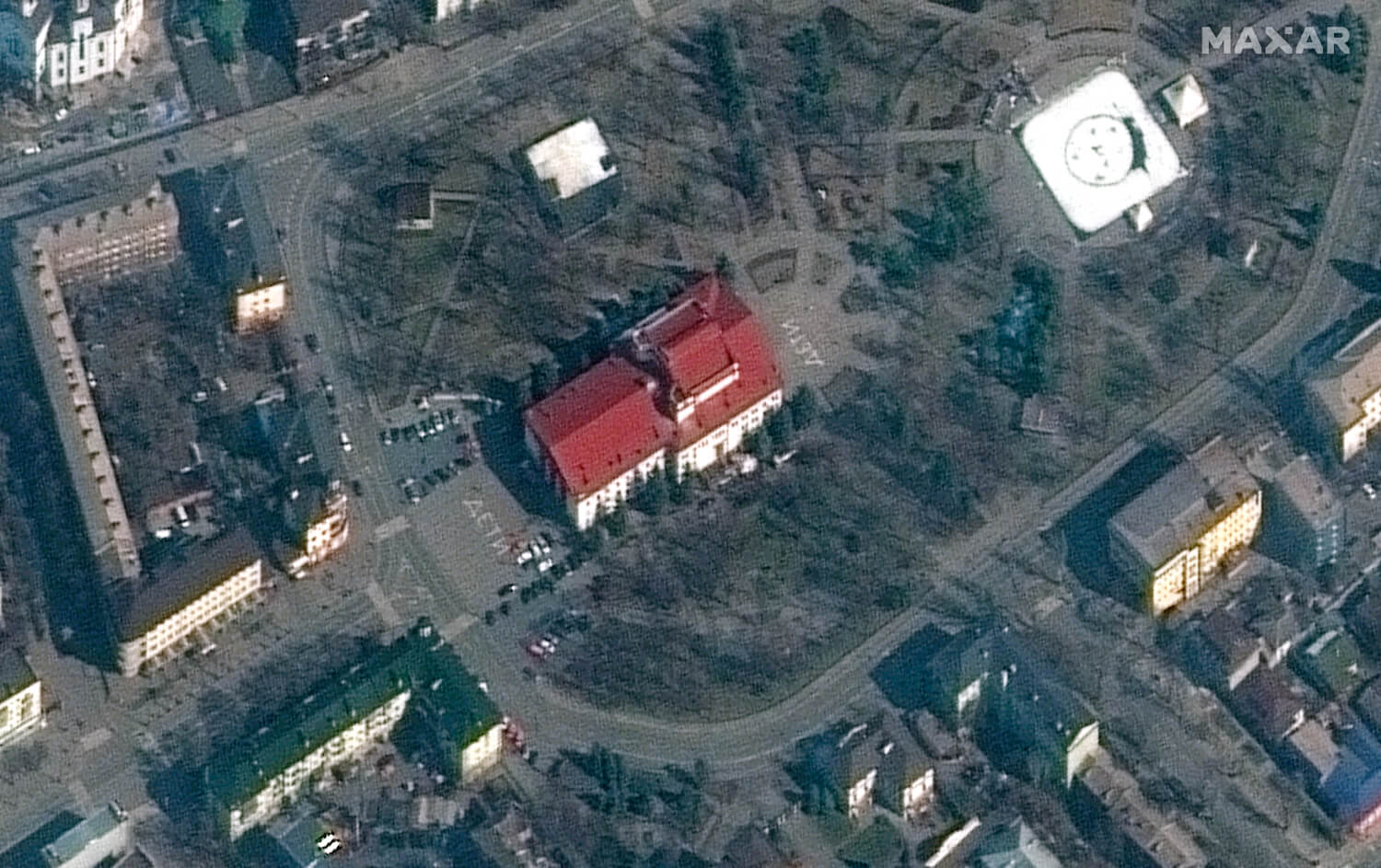Deutsches Theater in Rumänien
Foto: Deutsches Staatstheater Temeswar © Timișoara Text:Bülent Özdil, am 15. April 2025
Seit drei Jahren arbeitet der Schauspieler Bülent Özdil am Deutschen Staatstheater im rumänischen Temeswar. Dort erfüllte er sich einen Traum: den legendären Spielfilm „Der Spiegel“ von Andrej Tarkowski auf die Bühne zu bringen. Hier schildert er die Widrigkeiten bei der Umsetzung.
Deutschsprachiges Theater, Rumänien, Banat, Türke, der kein türkisch kann, Tarkowskyi. Das klingt nach einem Puzzle, in dem die Teile absichtlich nicht zueinander passen. Das Theater, wo all das zusammenkam, ist historisches Relikt, das seine Zeit überlebt hat. Es war für eine Minderheit da, die kaum mehr existiert. Und dennoch steht es noch da. Braucht es keinen Empfänger, existiert es, auch ohne Rezipienten?
Andererseits ist die Nachfrage nach den Aufführungen von „der Spiegel“ iin Temeswar so groß, dass wir an beiden bisherigen Vorstellungen bis zu 15 Besucher hatten, die vor Beginn neben der Bühne darauf warteten, ob nicht vielleicht doch jemand nicht gekommen ist, um sich noch ins Partett zu setzen. Hängt das Interesse an Tarkowsklis Vorlage mit dem Kommunismus zusammen, der hier gewütet hat. Tarkowski gehört hier auch zur Allgemeinbildung wie Goethe in Deutschland. Jeder kennt ihn, auch wenn man nicht unbedingt seine Filme gesehen hat.
Deutsche Kultur
Die deutsche Sprache hat hier im Banat einen besonderen Stellenwert. Historisch begründet durch die Ansiedlung der später sogenannten Banater Schwaben, ist hier über die Jahrhunderte eine besondere deutsche Kultur gewachsen. Den Menschen in Deutschland ist das gar nicht bewusst, wie groß der Einfluss hier war. Nun sind nur noch wenige Banater Schwaben hier ansässig, das Theater ist 70 Jahre alt. Rumänen schicken hier Ihre Kinder auf deutsche Schulen und die Zuschauer sind zu 90 Prozent nichtdeutschsprachig. Nur wenige sprechen flüssige Deutsch.

Szene aus „Der Spiegel” © Klaus Buland
Als Ich Tarkowskis Film „Der Spiegel” zum ersten Mal sah, war ich taub. So taub, dass ich dachte, ich muss ihn mir nochmal ansehen. Nach dem zweiten Mal war ich erschüttert. Wann passiert das einem schon mal? Erschütterung durch Kunst. Meine Inszenierung unternimmt den Versuch, zum einen Tarkowskis „Spiegel“ adäquat auf die Bühne zu bringen, aber gleichzeitig auch die Zugänglichkeit zu vereinfachen.
Russland einst und jetzt
Aufgrund des sehr assoziativen Filmes war es ein Anliegen, das, was ich verstanden habe, auch dem Publikum zu vermitteln. Da ist zum einen der Konflikt zwischen Russen und Ukrainern, der im Film angedeutet wird und durch den aktuellen Krieg an Aktualität gewonnen hat. Aus Stalin wird auf der Bühne Putin, aus dem zweiten Weltkrieg, der Angriffskrieg Russlands. Hinzu kommt eine tiefergehende Analyse Tarkowskis, was die Identität Russlands im Bezug zu Europa angeht. Ein im Film vorgelesener 200 Jahre alter Brief von Puschkin an den Philosophen Tschaadajew, seziert auf erschreckend simple aber sehr nachvollziehbare Weise, warum Russland zwar Europa zugeordnet wird, aber gleichzeitig der europäischen Welt fremd ist. Diese Analyse ist sowohl in den 1970er Jahren, als der Film entstand, als auch heute von großer Aktualität.
Das besondere an der Inszenierung ist neben der Verschiebung in unsere heutige Zeit, die Nutzung von KI. Nicht um der reinen Spielerei Willen, sondern, weil der Film sehr stark mit Erinnerungen verknüpft ist. Diese gepaart mit einer Sehnsucht nach der Kindheit und dem nostalgischen Unterton, führt zu einer Idealisierung die in seiner Melancholie sogar toxisch wird. Die KIs unterstützen den Aspekt der Verfälschung von Erinnerungen. Die Bilder erscheinen nicht astrein. Sie bewegen sich ein bis zwei Stufen unterhalb der „Realität”. Diese Bildsprache unterstützt die innere Bilderreise, die der Protagonist unternimmt.

Szene aus „Der Spiegel” © Klaus Buland
Bei der Produktion gab es einige Probleme am Theater. Der Probenraum wurde mir weggenommen. Der Stellvertretende Opernintendant hatte beschlossen, dass der behelfsmäßige Probenraum, der von allen vier Theatern hier als Lagerraum verwendet wird, auch nur zur Lagerung verwendet werden darf, und nicht für irgendwelche hochtrabenden Produktionen. Zum Glück wurde eine Alternative, eine alte Villa am Fluss mit Blick auf die große Kathedrale. Im Westen unbezahlbar – hier Leerstand. Unfassbar alles.
Eine neue Form von Theater?
Ich persönlich möchte aber immer noch eine neue Form von Theater schaffen. Eine pure, ironiebefreite. Deswegen habe ich drei Jahre Vorbereitung geleistet und zwölftausend Euro bezahlt. Theater schafft für mich in den letzten Jahren eine immer größere Distanz zu einer echten Emotion ,in der der Betrachter sich wiederfinden kann. Der ironische Bruch ist fast zum fundamentalen Handwerk geworden. Und ich verstehe immer weniger, warum im Film diese Emotionen zugelassen werden, aber im Theater kaum noch. Ob ich das in der Inszenierung von „Der Spiegel“ geschafft habe?
Bülent Özdil wurde 1981 in Rothenburg in Franken geboren. Er besuchte in Wiesbaden die Schauspielschule und spielte in Wiesbaden, Feuchtwangen, Bern und Salzburg. Seit 2010 inszeniert er, meist selbst geschriebene Stücke. Seit 2022 spielt er am Deutschen Theater Temesvar.