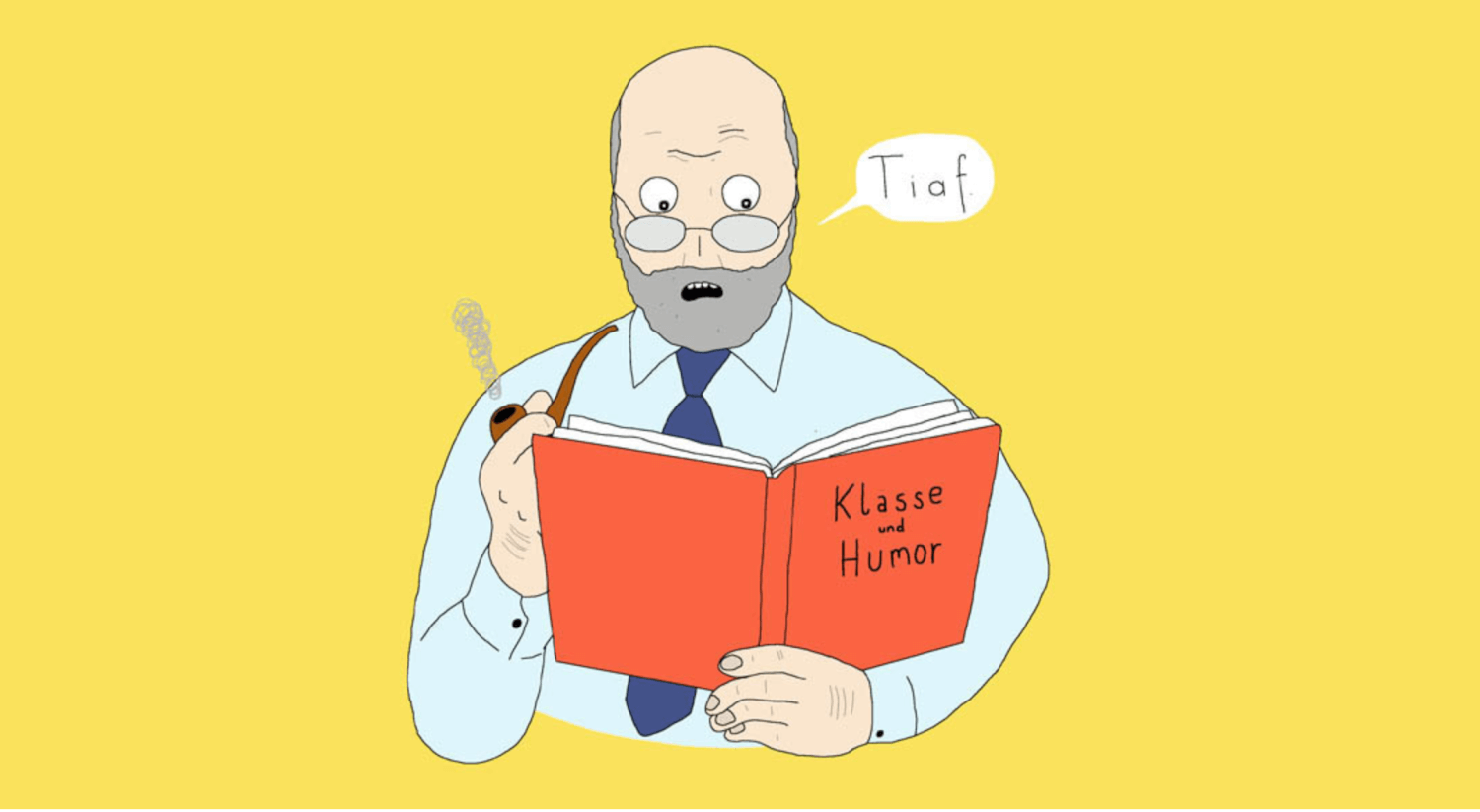„Ein Ort der Liebe, der Freundschaft und der Befreiung“
Foto: Die Ausrufung der Freien Republik Wien bei den Festwochen 2024 am Rathausplatz vor 36 000 Zuschauer:innen. © Franzi Kreis Text:Anne Fritsch, am 24. April 2025
Milo Rau leitet 2025 zum zweiten Mal die Wiener Festwochen. Das Programm sieht er als Gegenentwurf zu von Hass und Angst geprägten Debatten, das Festival als Widerspruch und als einen wahrhaft demokratischen Ort. Ein Gespräch über das Theater und die Welt.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: 2024, in Ihrem ersten Jahr bei den Wiener Festwochen, haben Sie am Rathausplatz mit Künstler:innen wie Pussy Riot und Elfriede Jelinek die Freie Republik Wien ausgerufen. Was war denn die Idee dahinter?
Milo Rau: Die Wiener Festwochen sind das größte Crossover-Festival, das wir hier haben auf diesem zusammenbrechenden Kontinent. Da wollte ich sowas wie ein ideales Modell einer Zivilgesellschaft entwerfen. Wir kennen alle diese aufklärerische Idee von Schiller und Lessing, das Theater könne im Idealfall so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit sein. Ein idealer, freier, antagonistischer, kritischer, aber auch von Liebe erfüllter Ort. Und ja, ich wollte dieses Festival mit all diesen Möglichkeiten politisieren.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Also das Festival als eine idealere Gesellschaft neben der nicht so idealen da draußen?
Milo Rau: So in der Art. Das hat auch ein bisschen mit meiner Erfahrung als Festivalbesucher und als Regisseur bei den Festwochen zu tun: Da habe ich mich oft gefragt, wie komme ich da vor? Ich stehe im Programm und habe eine Premierenfeier, aber wie komme ich mit der Stadt in Kontakt? Mit den anderen Künstler:innen und den Besucher:innen? Ich wollte herausfinden, was diese Stadt will. Deshalb habe ich den Rat der Republik gegründet. Damit das wirklich ein demokratisierendes Festival wird.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Demokratisierend ist ein sehr guter Ansatz in diesen Tagen.
Milo Rau: Was sind denn unsere Möglichkeiten? Wir sehen einen Zusammenbruch des parlamentarischen Systems durch Missbrauch der Autokraten, die einfach Mehrheiten herstellen mit Lügen, um dann die Demokratie und ihre Institutionen abzuschaffen. Aber wie Hannah Arendt sagte: Als einzelne haben wir keine Macht, aber gemeinsam sehr wohl. Darum verbünde ich mich mit ganz vielen Akteuren in der Stadt. Ich kann schließlich nicht ständig über Demokratisierung reden und in meinem Bereich nichts dafür tun.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Der Rat besteht in diesem Jahr aus 80 Wiener:innen, richtig?
Milo Rau: Ja, die kommen aus elf Partnerorganisationen in der Stadt, aus den verschiedensten Bezirken. Wir wollten eine demografische Vielfalt, von rechts bis links, von super gebildet bis quasi keine akademische Bildung, alle möglichen Berufe, Gender etc. Dazu kommen Expert:innen und ikonische Figuren, die in ihren Bereichen Demokratisierung ermöglicht haben.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Und wie sind diese Menschen eingebunden in die Planung?
Milo Rau: Es ist eine Mischung aus Demokratie und Expertokratie, also wie jede gute Institution. Wir integrieren Best Practice und Erfahrung, aber wir involvieren den Rat in alle Entscheidungen. Es gibt zum Beispiel Expertenanhörungen durch den Rat, der dann entscheidet, was umgesetzt werden soll. Wir machen auch außerhalb der Festivalwochen das ganze Jahr Programm und vernetzen uns.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Glauben Sie, dass man durch diese Öffnung in die Stadt oder die Gesellschaft auch Menschen außerhalb der üblichen Theaterbubble erreichen kann?
Milo Rau: Wir haben mit „Resistance Now“ eine Petition gegen die Bedrohung der kulturellen Vielfalt in Europa gemacht, die hatte 100 Millionen Leser:innen in 50 Ländern. Das funktioniert durch Kontakt mit Institutionen und Gruppen, die das weiterverbreiten und es brauchen können in ihrem eigenen Kampf. Wir müssen die unterschiedlichsten demokratischen Kräfte der Zivilgesellschaft verknüpfen, damit nicht alles zerfällt. Es gibt zu allem mehrere Meinungen und vielleicht sogar mehrere Wahrheiten. Manchmal gibt es Konflikte und manchmal gibt es Freundschaft. Und oft gibt es beides gleichzeitig. Wir sind halt komplizierte Wesen.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Spiegelt sich das auch im Programm wider?
Milo Rau: Wir rekonstruieren zum Beispiel eine ganze Nacht den Pelicot-Prozess. Wenn du dir das alles durchliest, bist du erstaunt, was dieser Dominique Pelicot auch für ein Mensch war: der allerliebste Großvater.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Beides in einer Person: Monster und Familienvater.
Milo Rau: Das ist verrückt, oder? Auf der einen Seite vollkommen verkommen und auf der anderen Seite ein Mensch, der seine Familie liebt, Angst hat vor Zwist und Streit. Das war keine kaputte Psychofamilie. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir einen Raum schaffen, in dem wir das verstehen können und die Komplexität akzeptieren, in dem wir die Erbärmlichkeit und Traurigkeit darstellen können. Und das kann die Kunst sein.

Milo Rau © Marc Driessen
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Warum sind solche Räume wichtig?
Milo Rau: Wir sind in einem permanenten Krisenzustand, schreien die anderen möglichst schnell herunter. Und das ist natürlich verständlich, wir müssen die Faschisten bekämpfen, damit wir noch eine Demokratie haben ein paar Monate oder Jahre.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Da hat sich der Ton wirklich sehr verändert in den letzten Jahren.
Milo Rau: Gestern war ich zufällig im Hotel Intercontinental, als Angela Merkel gleich daneben im Konzerthaus aus ihrem Buch vorgelesen hat. Ich habe ihr die Hand geschüttelt, ein Selfie mit ihr gemacht und gedacht, was war das für eine schöne Zeit, als diese Landesmutter noch irgendwie alles im Griff hatte. Und es ist im Grunde schade, dass die einzigen Ikonen, die wir noch haben, Leute wie Angela Merkel sind. Also Leute, die einfach ein Minimum an Anstand haben. Auch wenn ich ihre Regierung damals gar nicht als cool empfunden habe: Inzwischen ist alles so dekonstruiert, dass man sich zurücksehnt nach dieser Logik einer gewissen Moral.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Sie inszenieren im Rahmen der Festwochen Elfriede Jelineks Stück „Burgtheater“ am Burgtheater. Wie kam es zu dieser Idee?
Milo Rau: Seit ich in Wien bin, habe ich immer wieder Kontakt zu Elfriede Jelinek. Der Vorschlag, dass ich „Burgtheater“ machen soll, kam von Jelinek selbst und dem Dramaturgen Claus Philipp. Und für mich hat das gleich Sinn gemacht: „Burgtheater“, dieses Stück über Mitläufertum, am Burgtheater selbst. Ich bin nicht jemand, der irgendeinen Text inszeniert, aber das ist ja quasi eher Konzeptkunst. Wir machen das erst als Lesung zum Kriegsende-Jubiläum am 8. Mai, dann als analytische Installation ab dem 18. Mai 2025. Das ist ein Stück über den Faschismus und über das Burgtheater, am Ende ahnt man einen zweiten Faschismus.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Also ein Ende im Heute?
Milo Rau: Leider. Da wurde so viel in politische Bildung investiert und es hat nichts gebracht. Wenn ich mir die heutigen Politiker anschaue, sehne ich mich nach diesen Grand Dames wie Angela Merkel oder Elfriede Jelinek, die den Überblick haben, cool bleiben, radikal sind.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Ich finde Elfriede Jelinek doch noch auf eine andere Art radikal als Angela Merkel. Sie ist seit Jahrzehnten kontinuierlich eine so wichtige politische Stimme, die nie müde wird, sich zu Wort zu melden. Das ist schon sehr beeindruckend.
Milo Rau: Sie ist wirklich super und tough. Wir beide haben uns angefreundet, seit ich in Wien bin, und gucken manchmal gemeinsam Filme. Ich mag sie wirklich sehr und bewundere ihre Ehrlichkeit und ihre Intelligenz. Dabei hatte sie es nie leicht. Österreich kann ein sehr verletzendes niederträchtiges Land sein, wenn du in der Opposition bist.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Was zeichnet das diesjährige Festivalprogramm aus?
Milo Rau: Ich protze ungern, aber ich glaube, kuratorisch ist uns das perfekte Gesamtkunstwerk gelungen. Wir haben Großes, wir haben Kleines, wir haben Diskursives. Es gibt ein Stück aus Israel und ein palästinensisch-israelisches Tanzstück, einen Cancelling Prozess und die Reihe Brand New Classics, die der Frage nachgeht, wie wir Klassiker wirklich neu denken und machen können. Und wir wollen die Liebe als Überbegriff unserer Beziehungen etablieren, ob das nun ökonomische, familiäre oder Machtbeziehungen sind, solche zwischen Mensch und Natur, zu einem Text, sich selber oder zu einer Idee. Das ist quasi die Driving Force von allem, auf der Bühne und im Public Space. Wie können wir als Institution ein Ort der Liebe, der Freundschaft und der Befreiung sein? Ein Ort des Widerspruchs. Wir wollen uns nicht begrenzen aus Angst, zu groß, zu klein, zu konservativ oder zu demokratisch zu sein.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Also schon auch: einen Gegenentwurf zur Gesellschaft hinwerfen? Da draußen dominieren gerade Gefühle wie Hass und Angst den Diskurs…
Milo Rau: Genau, das ist gut formuliert. Was ziemlich bitter ist. Natürlich ist die Grundfrage, wie kann man als Festival ein zugänglicher Ort sein? Ich komme aus dem Kleinbürgertum und wenn ich ein Theater betrete oder ein Museum, dann fühle ich mich noch heute, nach 20 Jahren Arbeit in diesen Institutionen, physisch unwohl und fehl am Platz. Wie kriegt man das aus dem Körper heraus? Das sind so Fragen, die für mich im Zentrum stehen. Bei den Wiener Festwochen gab es lange kein Festivalzentrum mehr, nur noch wunderschöne, schwer zu verstehende Tanzperformances – und dann musstest du an den Würstelstand oder nach Hause. Das will ich ändern, und deshalb gibt es auch das Funkhaus, das Haus der Republik.
DIE DEUTSCHE BÜHNE: Und dort gibt es ein Begleitprogramm?
Milo Rau: Genau, und das alles ist mindestens so wichtig wie das, was an Programm läuft. Es gibt Partys, wir haben eine eigene Band, offene Büros, alles Mögliche. Ich will, dass die Leute ins Programm schauen und denken: What the fuck, was haben die Irren sich denn jetzt wieder gedacht? Dass sie hingehen, um sich Produktionen anzuschauen, aber auch, um einfach dabei zu sein.
Dieses Interview ist erschienen im Sonderheft Festivals 2025 der DEUTSCHEN BÜHNE.